AEC / CEEC Tagung
2. Oktober 1998
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Ermittlung von
Baukosten in der Schweiz
Referent:
Martin Wright
Bauökonom / Economiste de la Construction
AEC
Chartered Quantity Surveyor ARICS
PBK AG, Joweid Zentrum 1, CH-8630 Rüti / Zürich
Tel +41(0)55 250
33 80 / Fax +41(0)55 250 33 81 / E-mail wright@pbk-ag.ch
Heute hält die professionelle Baukostenplanung bei Bauprojekten auch in
der Schweiz immer mehr Einzug. Wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen
haben das CRB [1] mit seinen
Arbeitsmitteln und die, in der Schweizerischen Gesellschaft für Bauökonomie AEC
[2] organisierten, Baufachleute. Die AEC
ist in diesem Herbst Gastgeberin für das europäische Komitee CEEC (Comité
Européen des Economistes de la Construction) und führt gleichzeitig eine Tagung
über Bauökonomie durch. Unter anderem wird dann von Vertretern der
CEEC-Mitgliedländer eine typische Kostenermittlung für ein vorher bestimmtes
Gebäude präsentiert. Der unten stehende Artikel ist eine Zusammenfassung der
Präsentation einer schweizerischen Kostenermittlung.
1993
wurde der Fachverband für Bauökonomie FVB als Vertreter der hauptberuflich
tätigen Bauökonomen/-innen gegründet. Parallel dazu wurde die
Schweizerische Gesellschaft für Bauökonomie als Vereinigung für alle an der
Bauökonomie Interessierten ins Leben gerufen. 1997 haben die zwei Verbände
fusioniert und sich mit einem Zentralverband, dezentralen Sektionen und
einer Fachkammer, die nur entsprechend qualifizierte, hauptberuflich tätige
Bauökonomen/-innen aufnimmt, neu organisiert. Die Fachkammer der AEC ist an
dem an der Fachhochschule Innerschweiz laufenden Ergänzungsstudium für
Bauökonomie massgeblich beteiligt.
AEC:
Schweizerische Gesellschaft für Bauökonmie / Association Suisse pour
l’Economie de la Construction
Das
Komitee CEEC wurde 1979 als Sprachrohr des Berufes der Bauökonomie in Europa
gegründet. Es setzt sich für die bauökonomische Betreuung durch
ausgebildete Fachleute ein. Die Mitglieder bestehen aus der jeweiligen
professionellen Organisation der einzelnen Länder, bzw. für Länder ohne
professionelle Organisation aus einzelnen persönlichen Mitgliedern oder
Beobachtern. Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Grossbritannien,
Holland, Irland, Italien, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien und die
Türkei sind vertreten. Für die Schweiz erfolgt die Vertretung durch die
AEC-Fachkammer.
Comité
Européen des Economistes de la Construction CEEC
Ausgangslage in der Schweiz
Bis in die siebziger Jahre wurde bei Bauobjekten in der Schweiz vor allem Kostenerfassung praktiziert – Projektkosten wurden zuerst sehr rudimentär geschätzt und anschliessend die Planung sehr weit durchgeführt als Basis für einen detaillierten Kostenvoranschlag. Ein solcher Kostenvoranschlag konnte oft als “Erfassung der schon verplanten Kosten” betitelt werden. Nicht selten ist der Kostenvoranschlag höher als vorgesehen ausgefallen, was grosse Änderungen oder sogar Neuplanung mit Terminverzögerungen und erhöhtem Planungsaufwand verursachte.
Heute wird stufenweise vorgegangen unter Anwendung moderner Methoden der Kostenplanung, die eine rechtzeitige Kostensteuerung zulassen. Damit können die Kosten in den ersten Planungsphasen beeinflusst werden, zu einem Zeitpunkt also, wo mit geringem Aufwand eine grosse Wirkung erzielt werden kann.
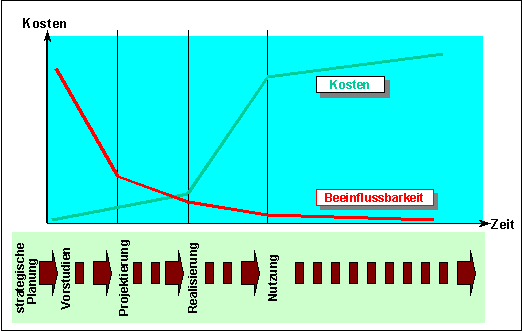
Beeinflussbarkeit der Kosten
Alte Methoden der Kostenermittlung nach Kubikmeter Rauminhalt liefern zwar Auskunft über die Grössenordnung der Kosten, sind aber wenig transparent und geben kaum Hinweise auf die Ursachen von Kosten. Ihre Genauigkeit wird in der SIA Leistungs- und Honorarordnung LHO SIA 102 [3] mit ± 20 bis ± 25 % verlangt – eine Bandbreite, die als Entscheidungsgrundlage für eine Bauinvestition völlig ungenügend ist.
Mit der heute in der Schweiz zum Standard gewordenen Elementmethode werden genauere, tranparentere Kostenvorhersagen zu einem frühen Zeitpunkt möglich. Entwurfsabhängige Kostenfaktoren werden mit Kennzahlen versehen, die schon in den ersten Planungsphasen einen Vergleich mit anderen Bauobjekten und auch eine rechtzeitige Beeinflussung ermöglichen.
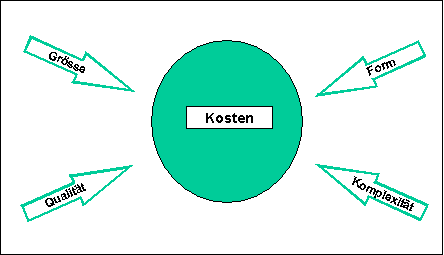
Entwurfsabhängige Faktoren
Wichtige entwurfsabhängige Faktoren können einzeln quantifiziert werden:
·
die Grösse
z.B. mit m3 Rauminhalt
oder m2 Geschossfläche (Hochbau) bzw. Bauwerkslänge oder -fläche (Tiefbau)
· die Form durch Verhältniszahl z.B. Formquotient Elementmenge/Geschossfläche
· die Qualität durch Kennwert pro Elementeinheit z.B. Dachkosten pro m2 Dach.
· die Komplexität z.B. durch den Anteil der Haustechnik.
Beim vorgegebenen CEEC-Projektbeispiel für den AEC-Kongress in Lausanne (siehe Kasten) ist die Gebäudeform schon bestimmt, was eine der ersten Stufen der Kostenplanung, die Optimierung von Flächen und Form, überspringt. Bei solchen Optimierungen werden die Daten aus mehreren Vergleichsobjekten einander gegenübergestellt. Dadurch können die kostenverursachenden Eigenschaften identifiziert und hinterfragt werden. Diese betreffen einerseits Verhältnisse der Geschossflächen, Nutzflächen, Verkehrs- und Konstruktionsflächen, andererseits aber auch die sogenannten Formquotienten, die Verhältnisse zwischen Elementmengen und Geschossflächen.
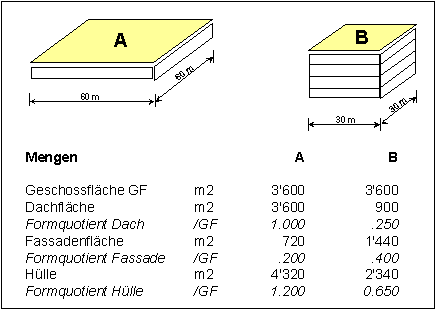
Formquotient FQ
Die Mengenermittlung
Als erster Schritt für die Kostenermittlung müssen die Bezugsmengen ermittelt werden. Für das CEEC-Projektbeispiel wurde ein Muster-Leistungsverzeichnis aus Dänemark zur Verfügung gestellt. Dadurch reduziert sich das Ausmass auf die Grundmengen wie Geschossfläche und Rauminhalt sowie die Element-Mengen wie Dach- und Fassadenfläche nach den schweizerischen Messvorschriften. Die Mengen wurden schnell und effizient anhand der Planvorlagen mit einem elektronischen Digitizer-System ermittelt, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Resultate protokolliert werden.
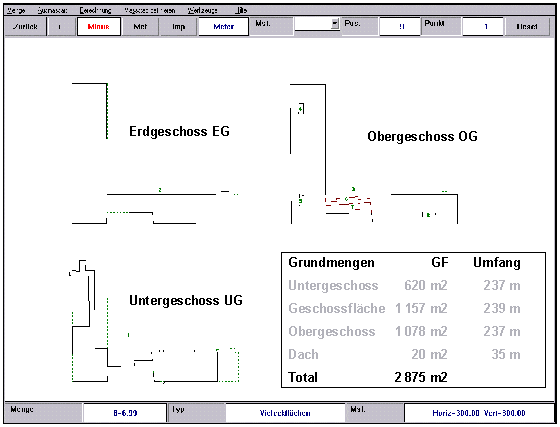
Ausmass der Geschossflächen mit Digitizer
Nach der Ermittlung der Mengen wurden die Resultate mit den dänischen Werten verglichen und Stichproben gemacht über die Totale der dänischen Teilmengen und die gemessenen Elementmengen. Es wurde eine gute Übereinstimmung bei den Elementmengen, aber ein grosser Unterschied bei der Geschossfläche festgestellt. Offenbar wird in Dänemark die Geschossfläche anders definiert als in der Schweiz (unter dem Begriff Geschossfläche wurde bei den zur Verfügung gestellten Unterlagen die eigentliche Nutzfläche von 1'800 m2 ausgewiesen gegenüber 2'875 m2 Geschossfläche nach SIA 416 [4]). Dies zeigt die Gefahren von oberflächlichen Vergleichen internationaler Kennzahlen auf der Basis von Kosten pro m2.
Die Kostenermittlung
Kostenermittlungen bilden eine wesentliche Grundlage für die Kostenplanung und ‑steuerung.
Die von der Zentralstelle für Baurationalisierung CRB herausgegebene Elementkostengliederung EKG [5] ist der rote Faden durch alle Phasen der Planung und Ausführung:
Nach der heute gut eingeführten Systematik des CRB kommen vier Stufen von Kostenermittlung zum Tragen:
· Kostengrobschätzungen nach Elementgruppen und Makroelementen der EKG
· Kostenschätzung nach den EKG-Elementen
· Kostenberechnung nach Berechnungselementen
· Umschlüsselung der Kostenberechnung nach Ausschreibungspaketen
|
Phase: |
Vorstudien |
Vorprojekt |
Bauprojekt |
Realisierung |
|
Art der Ermittlung: |
Kostengrobschäzung |
Kostenschätzung
nach Elementen |
Kostenberechnung |
Umschlüsselung
nach Ausschreibungspaketen |
|
Ebene |
Elementgruppen
und Makroelemente |
EKG-Elemente |
Berechnungs-elemente |
BKP/NPK-Kapitel |
|
Ergebnisse: |
EKG: - Elementgruppen - Makroelemente |
EKG: - Elementgruppen - Makroelemente - Elemente |
EKG: - Elementgruppen - Makroelemente - Elemente - Berechnungs-elemente - |
BKP / NPK + EKG: - Elementgruppen - Makroelemente - Elemente |
Stufen der Kostenermittlung
Die Kostengrobschätzung
Die erste Kostenermittlung des CEEC-Projektbeispiels erfolgte als Kostengrobschätzung nach Elementgruppen und Makroelementen basierend auf wenigen Parametern, welche Form und Qualität der Gebäudehüllen berücksichtigen. Solche Kostenermittlungen erfolgen normalerweise anhand der ersten Skizzen und erlauben es, frühzeitig, mit wenig Aufwand verschiedene Alternativen zu vergleichen und unterschiedliche Modelle zu erarbeiten.
Schon in den allerersten Skizzen sind die Mengen von Fassaden, Dächern und Bodenplatten ersichtlich. Bekannt ist auch, ob es sich um teure oder billige Ausführungsqualitäten handelt. Mit der Quantifizierung der Mengen und Kostenkennwerte werden diese Parameter einzeln berücksichtigt.
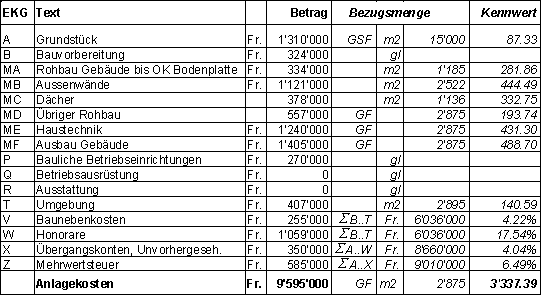
Beispiel Kostengrobschätzung
Die Kennwerte basieren auf Vergleichswerten aus anderen Objekten, die für den vorgesehenen Standard angepasst werden.
Die Verwendung einer Datenbasis von Projektauswertungen bildet eine enorme Hilfe bei der Bestimmung der anzuwendenden Kennwerte. Die Vergleichsdaten können sehr effizient anhand Suchkriterien zusammengestellt, auf einem einheitlichen Preisstand aktualisiert und beurteilt werden. Sehr wesentlich dabei sind die den Kennwert ergänzenden textlichen und grafischen Informationen. Anhand dieser Daten können die Unterschiede bei den Vergleichszahlen gezielt untersucht werden als Grundlage für die Schätzung der Werte für das neue Projekt.
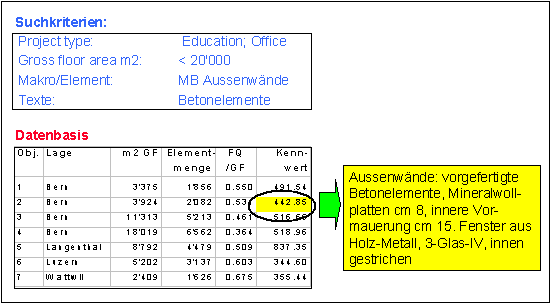
Kenwertdatenbasis
Auswertungen der eigenen Objekte liefern den Planern die wichtigsten Kennwerte. Diese können ergänzt werden mit den Kennwerten aus dem von CRB herausgegebenen BKK-Katalog [6]
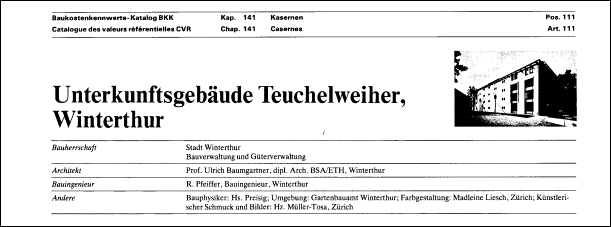
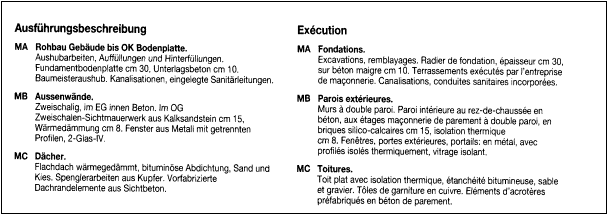
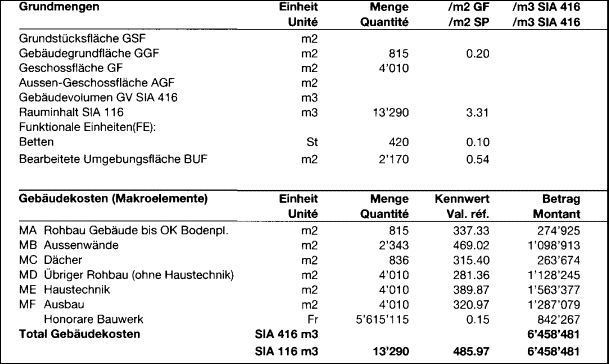
Auszug aus
Baukostenkennwert-Katalog BKK
Die Kostenschätzung nach Elementen
Die Kostenschätzung nach Elementen ist etwas detaillierter als die Kostengrobschätzung und basiert in der Regel auf weiteren Planungsschritten (z.B. dem Vorprojekt, mit Plänen Mst. 1:200 und einer Beschreibung des vorgesehenen Ausführungsstandards). Die Ermittlung erfolgt direkt auf der Ebene der EKG-Elemente und beschränkt sich auf rund 100 Elemente, wovon nur ein Anteil beim jeweiligen Objekt vorkommt. Die Elemente werden einzeln geschätzt anhand der wichtigsten Mengen sowie von Kennwerten für die entsprechende Ausführung.
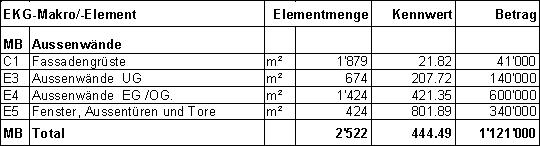
Elementschätzung für
Makroelement Aussenwände
Auch hier liefern Auswertungen der eigenen Objekte die wichtigsten Kennwerte. Auch hier können sie aber ergänzt werden mit den Kennwerten aus dem von CRB herausgegebenen BKK-Katalog
Die Darstellung der Kostenschätzung nach Elementen erfolgt in der Regel in Form von einer Baukostenanalyse nach EKG (siehe separate Beilage). Für das CEEC-Beispielprojekt wurden diese Arbeitsschritte übersprungen, weil die Leistungsverzeichnisse aus Dänemark schon eine detailliertere Berechnung ermöglichten.
Die Kostenberechnung nach Berechnungselementen
Bei der Kostenberechnung nach Berechnungselementen sind weitere Planungsschritte und Informationen über die vorgesehenen Ausführungen notwendig. Die EKG-Elemente werden bei dieser Kostenermittlung weiter unterteilt in sogenannte Berechnungselemente, die den unterschiedlichen Ausführungsarten entsprechen. Die Berechnungselemente beziehen sich aber weiterhin auf mengenmässig einfach erfassbare Teile eines Bauobjektes.
Das Musterleistungsverzeichnis aus Dänemark war nach den Elementen des SfB-Systems [7] gegliedert. Die SfB-Elemente konnten mit sehr wenig Ausnahmen direkt den schweizerischen EKG-Elementen zugeordnet werden, was auch die Bedeutung der Elemente für grenzüberschreitendes Arbeiten unterstreicht. Ebenfalls direkt zugeordnet wurden die Arbeitsgattungen nach dem Baukostenplan BKP[8], dessen 3-stelligen Begriffe den Ausschreibungspaketen entsprechen.
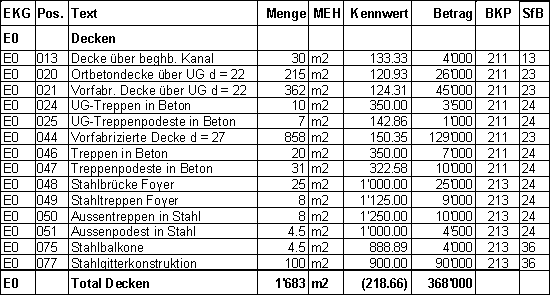
Auszug aus einer Kostenberechnung
(Element E0 Decken, Berechnungselemente gemäss CEEC-Projektbeispiel)
Die Preisansätze für die Berechnungselemente basieren auf Erfahrungswerten oder auf einem Aufbau nach Leistungspositionen.
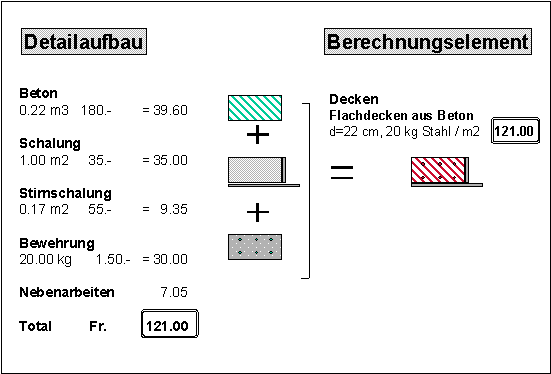
Aufbau eines Berechnungselementes
Eine grosse Sammlung von Berechnungselementen mit Richtwerten wird von CRB als BEK-Katalog [9]) publiziert.
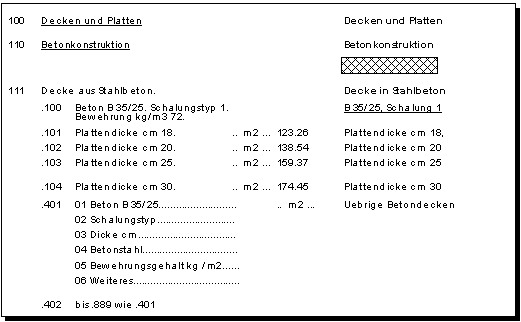
Auszug aus BEK-Katalog
Die CRB-Berechnungselemente sind aus Leistungspositionen nach dem Normpositionen-Katalog NPK [10] bzw. dem BAUHANDBUCH [11] und Richtpreisen aufgebaut. Sie müssen vom Anwender inhaltlich (Mengenanteile) sowie preislich (Berücksichtigung der Marktsituation) angepasst werden.
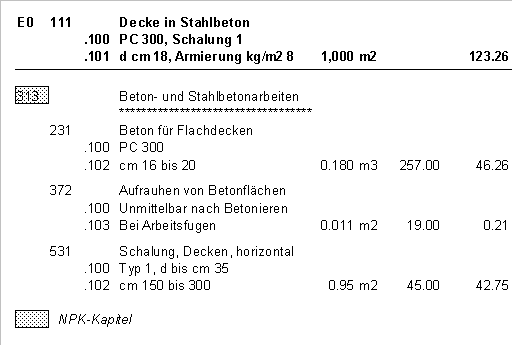
Preisaufbau für Berechnungselement (Auszug)
Die Umschlüsselung nach Auschreibungspaketen
Für die Ausführungsphase eines Bauobjekts müssen Zielwerte für die Vergabe der Arbeiten an Unternehmer bestimmt werden. Diese richten sich primär nicht nach den planungsorientierten Elementen, sondern unternehmerorientierten Kriterien (z.B. Baumeisterarbeiten, Spenglerarbeiten, Elektroarbeiten). Durch die Codierung der Kostenberechnung nach den vorgesehenen Ausschreibungspaketen (z.B. nach Baukostenplan BKP) können die entsprechenden Beträge auf einfache Art und Weise umsortiert werden.
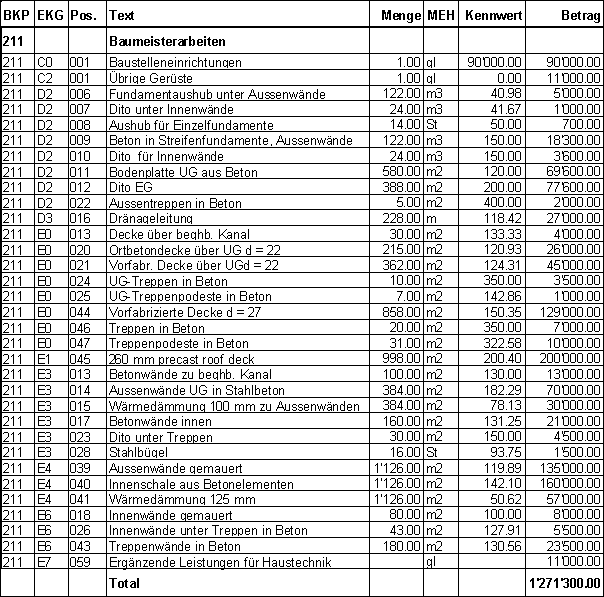
Umsortierung nach BKP (Berechnungselemente gemäss CEEC-Projektbeispiel)
Falls alle Berechungselemente im Detail nach Leistungspositionen aufgebaut sind, kann auch eine Umsortierung direkt als approximatives Leistungsverzeichnis (z. B. nach Normpositionen-Katalog NPK) erfolgen. Der detaillierte Aufbau aller Berechnungselemente ist aufwendig und in der Praxis häufig nicht möglich, weil die Planung nicht in allen Bereichen so weit fortgeschritten ist.
‘Top-Down’ Prinzip
In der Praxis werden Kostenermittlungen nicht stur nach den unterschiedlichen Stufen durchgerechnet. Statt dessen wird stufenweise vom Groben ins Feine gearbeitet, wobei nur die kostenrelevanten Teile jeweils weiterbehandelt werden. Mit dem Top-Down-Verfahren erfolgt eine erste Triage nach der obersten Stufe. Anschliessend werden nur Beträge, die eine gewisse Grösse (z.B. 5 % der Gesamtkosten) übersteigen auf der nächste Stufe weiter vertieft. Hier werden wiederum nur Positionen, welche die festgelegte Grösse übersteigen, detailliert untersucht.
Nach der 20/80 Regel befinden sich 80% der Kosten in 20% der Positionen. Mit dieser Methode können die wichtigsten 20% gezielt bearbeitet und die Klumpenrisiken ausgeschaltet werden.
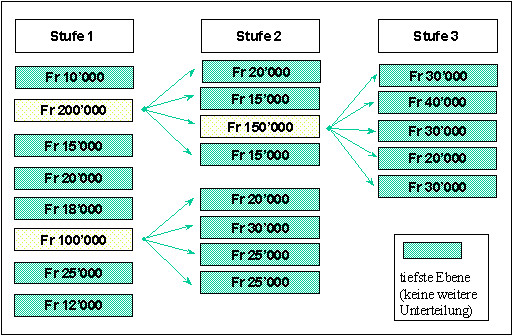
‘Top-Down’ Prinzip
Schlussbemerkungen
Die Kostenplanung nach Elementen ist nicht nur eine Methode der Kostenermittlung sondern vielmehr ein Instrument der Kostenplanung und -steuerung. Sie gestattet während Planung und Ausführung laufende Kontrolle mit der Möglichkeit Abweichungen von den Projektzielsetzungen rechtzeitig zu erkennen und allenfalls Korrekturmassnahmen zu treffen.
Heute verlangen Bauherren bessere Kostenermittlungen, mehr Kosteninformation, mehr Alternativuntersuchungen und mehr Transparenz. Durch speziell geschulte Fachleute, ein systematisches Vorgehen und den effizienten Einsatz der EDV kann diese Leistung erbracht und Bauprojekten Mehrwert verliehen werden.
Die Erfahrung
zeigt: mit konsequenter Kostenplanung kann die Qualität eines Gebäudes
innerhalb eines vorgegebenen Kostenrahmens deutlich erhöht werden.
Die
Elementkostengliederung EKG (Deckblatt)
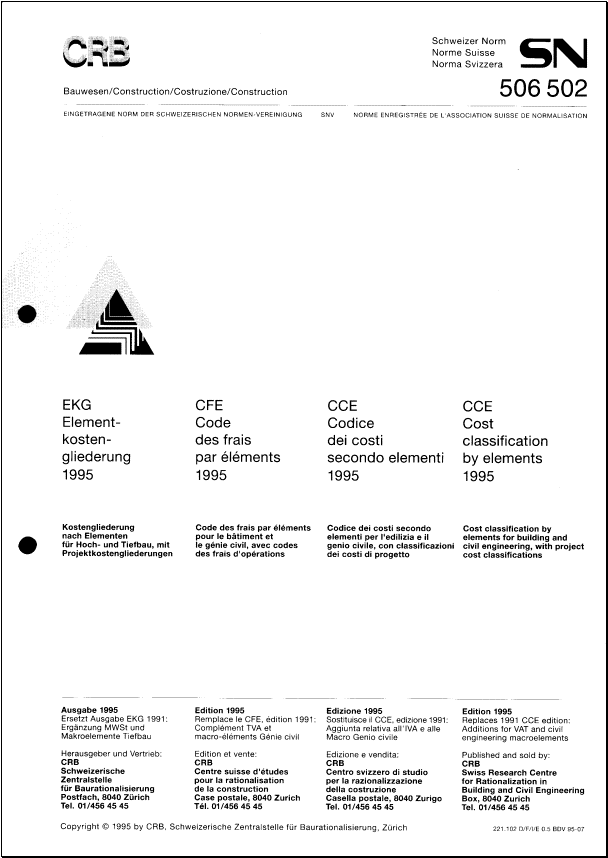
Baukostenanalyse
(Hochbau) nach EKG, Ausgabe 1995
CEEC Beispielprojekt
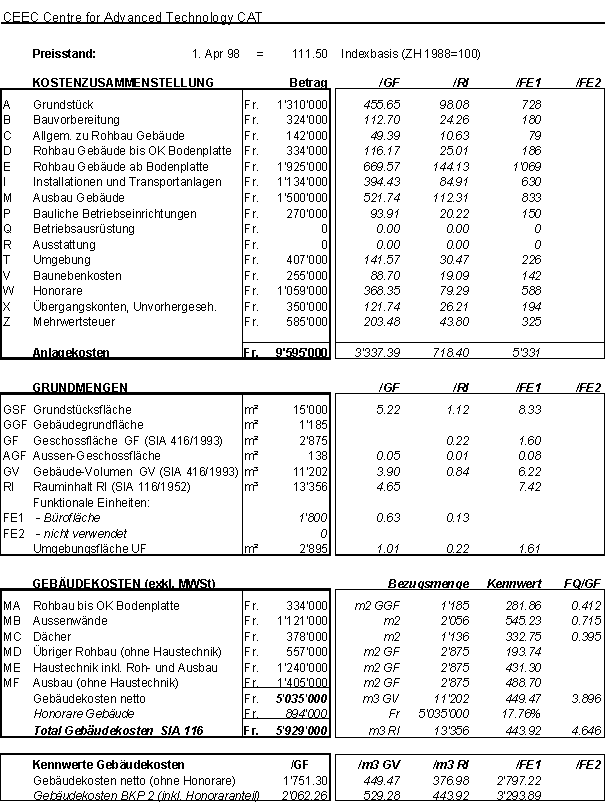
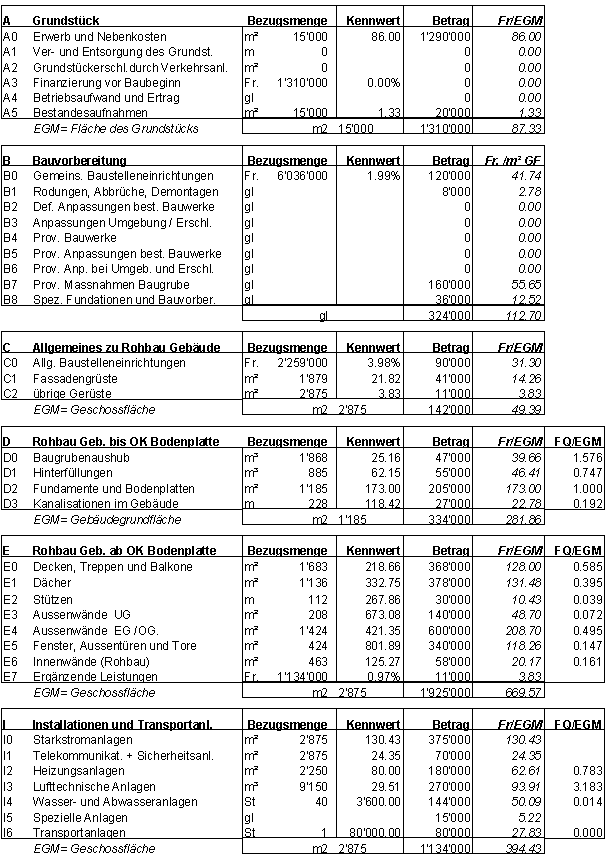
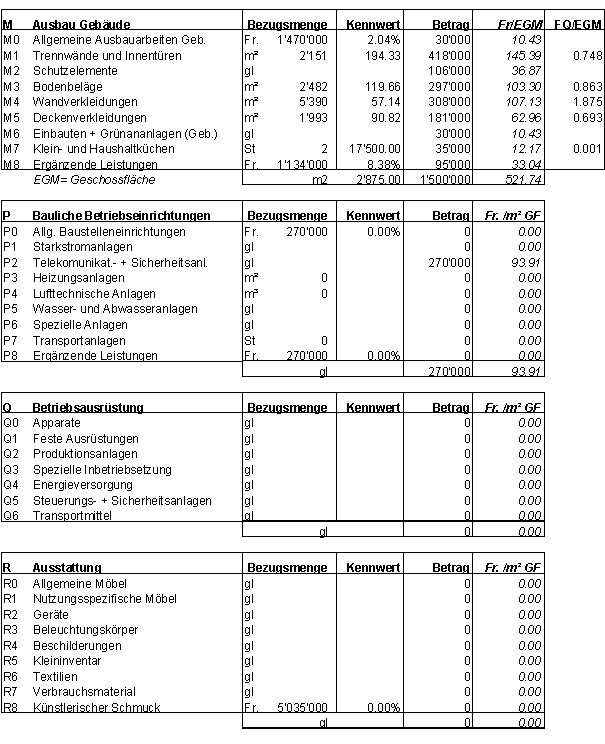
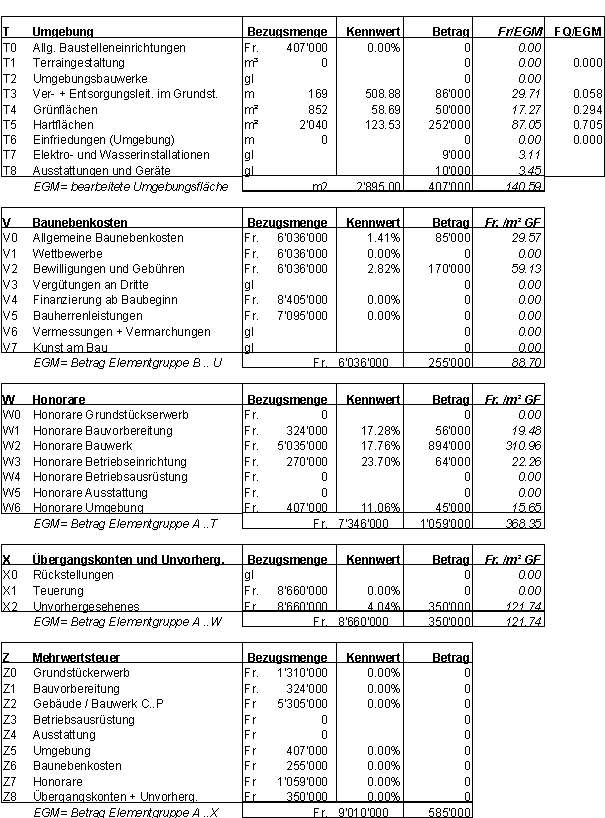
Referenzen